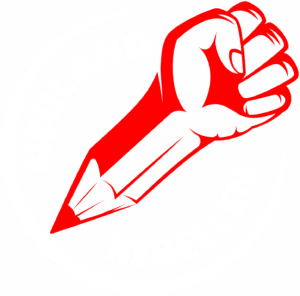Freundschaft, liebe Ossis!
Sie liebten und sie hassten ihn
»Unser Gerhard« trotz Hartz IV
Ihre Reformen waren aus ihrer Sicht richtig und alternativlos – das TINA-Prinzip hatte sie voll im Griff. Die Leute, die auf die Straße gingen, die Montagsdemonstrationen gegen den Sozialabbau besuchten, verunglimpften sie. Für die SPD waren diese Leute eine Mischung aus Querulantentum – heute würde man sie Querdenker nennen – und Begriffsstutzigkeit. Letzteres erklärte man so: Die Agenda 2010 würde nur deswegen nicht akzeptiert, weil sie nicht richtig vermittelt wurde. Die Leute seien dagegen, weil sie noch nicht verstanden haben, welche Segnungen darin schlummerten. Auf die Agenda ließen die Sozialdemokraten nichts kommen – auch nach Schröder nicht. Für einige Sozialdemokraten habe er zwar die Partei auf Abwege gebracht, aber so richtig gebrochen haben sie mit »unserem Gerhard« nicht. Noch nicht mal die Drehtür, also direkt aus einem politischen Amt auf einen Aufsichtsratsposten gestolpert zu sein, nahmen sie ihm krumm. Erst in den letzten Monaten hat man entdeckt, dass dieser Schritt Empörung bedarf. Wie immer bei der Sozialdemokratie: Mit jahrelanger Verspätung – und als andere sozialdemokratische Konstante ebenso: Aus den falschen Gründen. Nicht, dass er sein politisches Amt nutzte, um sich für die Wirtschaft zu empfehlen, machen sie ihm zum Vorwurf – das kam ihnen ja jahrelang nicht in den Sinn. Nein, weil er eine Nähe zu Russland zuließ, die jetzt als schmuddelig galt. Nun kann man jenem Gerhard Schröder viel vorwerfen. Und man muss es objektiv betrachtet auch tun, denn er hat seine Partei als »Alternative für Deutschland« aus dem Spiel genommen, ein politisches Vakuum entstehen lassen (was die Sozis aus der Zeit nach seiner Kanzlerschaft nochmal forcierten, indem sie in eine Dauerkoalition mit der Union gingen) – aber die wirtschaftliche Partnerschaft mit Russland war und ist ganz und gar nicht als Vorwurf geeignet. Ganz im Gegenteil, das war ein Schritt nicht nur in die richtige Richtung, sondern eben auch im Sinne des sozialdemokratischen Erbes.Wandel durch Handel
Wandel durch Annäherung: Diese Parole von Brandt und Bahr ist ja nicht nur so zu verstehen, dass man sich geschniegelt an einen Tisch hockt und Nettigkeiten austauscht. Da braucht es mehr: Wirtschaftliche Verbundenheit etwa. Das Abkommen über Gaslieferungen mit Russland, die Ostseepipeline im Konkreten: So näherte man sich an, so wandelte man die Umstände. Diesen Schritt zu gehen, kann man ihm nicht vorwerfen. It’s the economy, stupid! Potenzial zur Kritik wäre der Drehtüreffekt gewesen. Aber man schwieg – insbesondere wie bereits erwähnt unter Sozialdemokraten. Kein schlechtes Wort auf den Ex-Chef bitte. In den Jahren danach brach die Partei auch nicht mit dem Erbe jenes angeblich Dritten Weges, den er zusammen mit seinem blassroten Kollegen aus London eingehen wollte: Das Schröder-Blair-Papier blieb weiterhin die Leitlinie, die Sozialdemokratie verteidigte Hartz IV bis aufs Blut. Richtig sei das gewesen – wichtig sowieso. Fördern. Fordern. Wer das kritisierte, war ein gefallener Engel aus der Hölle. Einige Dissidenten wurden durch Zuteilung ministerieller Posten kaltgestellt. Grüße an Frau Nahles an dieser Stelle, die später sogar »Chefin« der Arbeitslosen wurde. Dass unter Schröder eine Kehrtwende stattfand: Als nominelle Kraft, die den Schwachen in der Gesellschaft dienen wollte, zu einer Truppe, die Schwache marginalisierte und kriminalisierte, dabei deren mögliche Perspektiven raubte: Die Partei hätte aufstehen müssen – und ein Parteiausschlussverfahren für den Gert wäre nur konsequent gewesen. Das alles gab es aber nicht. Schröder wurde danach als elder statesman verkauft, als einer, der es in der Welt zu was brachte – und obgleich die Partei an der Basis brodelte, trotzdem es Kritik an der Neoliberalisierung gab, lud man ihn auch mal zu Veranstaltungen ein, bei denen er als Großer der Sozialdemokratie vorgestellt wurde.Außen-Gerd und Innen-Gerd
Und kaum, dass es als unschicklich galt, zu viel Nähe zu Russland oder zu Russen zu haben, knicken die Sozialdemokraten ein und brechen mit Gerhard Schröder – über Jahre war man vielleicht nicht ganz glücklich mit ihm, schließlich war er kein Willy Brandt. Aber er war einer von ihnen, jemand, den sie Respekt entgegenbrachten, der in seiner Jugend mit dem Spitznamen Acker Fußball rumpelte, der also ein Anpacker war, ein Kämpfer – auch wenn er ihren Wählern schwere Zeiten einhandelte, ein Gerhard Schröder, es gab nur ein Gerhard Schröööder! Innenpolitisch hat er die Sozialdemokratie zerrissen, sein Kurs hat seine Partei von einer Volks- zu einer etwas größeren Kleinpartei gemacht. Sein Erbe, von dem sich die Sozialdemokraten nicht lösen wollten, hat bewirkt, dass mancher SPD-Kanzlerkandidat lächerliche Wahlergebnisse einfuhr. Aber all das nahm man hin, saß man aus, rechtfertigte man noch mit kecker Chuzpe. Ganz anders außenpolitisch: Nicht, dass Gerhard Schröder ein geopolitisches Naturtalent gewesen wäre. Der Anwalt aus Niedersachsen war kein Kosmopolit, er sah nur so aus in seinem Brioni-Anzug. Und so ein Zigarrenstumpen im Mundwinkel macht schnell weltläufiger, als man eigentlich ist. Aber so richtig viele Fehler hat er auf dem internationalen Parkett nicht begangen. Abenteuer im Irak schloss er aus, das kostete ihm Sympathien in Washington – auch wenn man hinzufügen muss: Natürlich war Deutschland via Ramstein am Irakkrieg beteiligt. Das warfen ihm auch etliche Kritiker vor. Aber vielleicht erwarteten sie zu viel von einem deutschen Kanzler – mehr als er zu leisten imstande war. Zögerlich hielt er die Bundeswehr im Irak heraus und ließ sich auch nicht umstimmen. Wer nicht für Bush war, war gegen ihn. Für einen Augenblick ließ das US-Regime ihn das spüren.Jens Bergers „Wem gehört Deutschland“ – 10 Jahre später
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenDirekt-Link Episode herunterladen Audio-Player:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenFußball nach Stimmungslage
Auferstehung
Im Verlauf eines Turniers oder bei Sieg und Niederlage werden mitunter unbewusste Wünsche oder Hoffnungen deutlich, die Fußball offenlegt oder erfüllt. Diese sind dem einzelnen nicht immer so klar und werden oftmals erst im Rückblick erkannt. Ein solches Ereignis war der Sieg der deutschen Nationalelf von 1954, der erste Weltmeistertitel, der bis heute immer noch sehr verklärt wird. Der Sieg beim WM-Turnier in der Schweiz war der Aufstieg des Phönix aus der Asche. „Wir sind wieder wer!“ Das war nun die vorherrschende Stimmung, nachdem die Niederlage im Krieg bis dahin sehr viele nicht hatten verwinden können. Dabei ging es wirtschaftlich wieder bergauf. Das Wirtschaftswunder war in großen Teilen der Bevölkerung bereits zu spüren, und doch hatte der deutschen Volksseele bis zum „Wunder von Bern“ etwas gefehlt. Der Sieg in einer Fußball-Weltmeisterschaft war für viele die Wiedergutmachung für die Schmach der Kriegsniederlage. Diese war so unverständlich und unglaublich gewesen nach all den Prophezeiungen und Versicherungen der Vorsehung, dass der Traum vom Endsieg noch Jahre nach dem Krieg in vielen Köpfen weiter spukte. Dabei war eines für die meisten Kriegsteilnehmer vollkommen klar: Es hatte nicht am deutschen Landser gelegen. Der war sauber und ehrlich gewesen, hatte heldenhaft gekämpft und hatte sich keine Vorwürfe zu machen weder für die Niederlage noch für alles, was im Krieg geschehen war. Aber alle Zweifel, Demütigungen und Schuldzuweisungen waren vergessen nach dem Sieg in Bern. Er war der Wundverband für die geschundene deutsche Seele. „Wir sind wieder wer! Wir lassen nicht länger auf uns herumtrampeln“ In dieser erlösten Stimmung standen Hunderttausende an der Bahnstrecke, bei Durchfahrt und Ankunft in den Bahnhöfen und jubelten dem „roten Blitz“ zu, jenem Zug mit den Siegern und Helden von Bern. Im Überschwang des Siegesgefühls erscholl aus Hunderttausenden Kehlen das Deutschlandlied, die erste Strophe, die Deutschlands Größe besang, hier als Auferstehung. Dabei ging es nicht um die geographische, es ging um die wieder errungene nationale Größe. Es war der verspätete Triumphzug heimkehrender Helden. Wenn sie auch nicht als Sieger aus der Sowjetunion heimkehrten, so doch nach einer vergleichbaren Schlacht, in der niemand mit dem Sieg der Kriegsverlierer gerechnet hatte. Es war ein zweites „Deutschland erwache!“ Man hatte der Welt gezeigt, dass man siegen konnte. Deutschland-West schwamm auf einer Welle des Nationalstolzes und der Genugtuung. Der Sieg in Bern war für viele die Wiedergutmachung für die Niederlage im Krieg.Gute Nachbarn
Unter einem ganz anderen Stern und einer davon vollkommen verschiedenen Stimmung fand die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland statt. Der Krieg war für die meisten lange vorbei. Eine junge Generation war herangewachsen, eine moderne, aufmüpfige. Die Studentenbewegung hatte das Land durchgeschüttelt. Alte Zöpfe waren ab, man trug das Haar offen, auch die Männer. Sexualität und Lust, Lebensfreude und Wohlstand waren die Themen der Zeit. Deutschland zelebrierte Weltoffenheit. Die Deutschen waren sympathisch geworden. Willy Brandt suchte die Aussöhnung mit den Nachbarn im Osten. In Warschau hatte er vor den Opfern von Krieg und Faschismus niedergekniet und um Vergebung gebeten. Die Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion sollte die Gefahr eines Atomkriegs mindern. „Wir wollen ein Volk von guten Nachbarn sein“, hatte Brandt das Ziel seiner Politik beschrieben, und so war auch die Fußball-WM 1974 in Deutschland. Sie passte zur Stimmung im Land, in Europa und in der Welt. Die Kriegsgegner von einst waren Freunde geworden, zumindest im Westen. Seit dreißig Jahren herrschte nun Frieden in Europa. Wenn auch in anderen Teilen der Welt, besonders in Vietnam noch immer erbittert gekämpft wurde, so war doch 1974 schon zu erkennen: Vietnam und damit ganz Südostasien würden den Sieg davon tragen über den amerikanischen Imperialismus. Aber Vietnam war trotz seiner weltpolitischen Bedeutung für die meisten weit weg. In Europa herrschte Frieden und die Weltmeisterschaft in Deutschland war verbunden mit der Hoffnung auf Frieden in der Welt. In guter Nachbarschaft lebten die Völker ohne größere nationale Spannungen zusammen und feierten die Spiele, den Sport, den Wettkampf und die Freude am Spiel.Satte Nachbarn
Die Weltmeisterschaft 1990 in Italien brachte Deutschland den dritten Titel. Die gesellschaftliche Stimmung stand unter dem Eindruck der deutschen Wiedervereinigung. Die Mauer war gefallen, der kalte Krieg war übergegangen in einen lauwarmen Frieden. Deutschland war in Hochstimmung, weil endlich zusammenwachsen konnte, von dem man glaubte, dass es zusammen gehörte. Der Jubel der Wiedervereinigung schwang noch in der deutschen Volksseele. Sie war ein unerwartetes und auch unverdientes Geschenk für die damals regierende CDU. Denn bis zum Zeitpunkt des Mauerfalls war die Stimmung eigentlich nicht mehr so rosig. Das Wirtschaftswunder hatte Glanz und Zauber verloren. Es ging zwar immer noch bergauf, aber mühsamer. Wirtschaftskrisen und Börsenkräche hatten Spuren im Gemüt hinterlassen. Es lief nicht schlecht in Deutschland, aber das Land dümpelte dahin wie das Spiel der deutschen Mannschaft in der Zeit davor. Die Wiedervereinigung brachte neuen Schwung. Zudem hatte der deutsche Fußball durch die „Lichtgestalt“ Franz Beckenbauer einen neuen Hoffnungsträger gefunden nach den durchwachsenen Leistungen unter seinen Vorgängern. Der Weltmeister-Titel kam eher unerwartet. Die Aufbruchstimmung in der Gesellschaft und ein Wunsch nach Neuanfang hatten Rückenwind gegeben. Anders zwar als 1954 nach dem verlorenen Krieg war man wieder wer, aber nur weil Deutschland größer geworden war. Der WM-Titel und die DDR waren das Zuckerl obendrauf für eine Gesellschaft, die schon ziemlich satt war.Spielball der Werte
Mit welcher gesellschaftlichen Stimmung der WM-Titel von 2014 einher ging, ist schwer zu sagen. Vielleicht war es eine relative Sorglosigkeit, die sich noch einmal wohlig über das Land breitete. Die große Finanzkrise von 2008 war vorüber und glimpflicher verlaufen, als anfangs zu befürchten gewesen war. Unbekümmerte Unbeschwertheit war ihr nach den ersten Jahren vorsichtiger Erholung gefolgt. Es war doch alles nicht so schlimm gewesen, und es war noch einmal gutgegangen. Mit der Weltmeisterschaft in Russland 2018 hatte sich ein Stimmungswandel angedeutet, der sich ganz deutlich bei der WM in Qatar 2022 offenbarte. Die deutsche Gesellschaft begann, unter dem wachsenden Einfluss der Missionare des Wertedenkens missmutig zu werden. Der innere Frieden und die Freude am Spiel hatten bereits 2018 unter dem Gemäkel und der Propaganda gegenüber dem Gastgeber Russland gelitten. Mehr oder weniger versteckte Vorwürfe gegenüber der Mannschaft wurden laut vonseiten der Hohepriester der Doppelmoral für deren Teilnahme an dem Turnier in Putins Autokratie. In Katar wollte man es dann besser machen. Die Mannschaft trat auf als Botschafter einer Gesellschaft, in der Werte und Moral über allem standen, auch über dem Sport. Was schon zu Hause nicht gut ankam, wurde draußen in der Welt noch weniger geschätzt. Die deutsche Mannschaft trat unter dem Gespött derjenigen die Heimkehr an, die man in Sachen Diskriminierung hatte belehren und bekehren wollen. Der deutsche Fußball jedenfalls bot keine Lehrstunde wie noch 2014 in Brasilien und noch weniger hatte er die Welt zu einem besseren Ort machen können.Neuer Geist?
Das kommende Turnier ist keine Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft muss sich nur mit europäischen Nachbarn vergleichen. Sie muss keine Mission erfüllen wie noch in Katar. In Europa sind die „Guten“ unter sich. Die Russen wurden ausgeladen. Im Moment kann noch nicht gesagt werden, ob und wie sich die miserable gesellschaftliche Stimmung in Deutschland auf Spiel und Geist der Mannschaft auswirkt. Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann scheint ein Neuanfang gelungen, der bisher schon länger hält als die gewöhnlichen Anfangserfolge der neuen Besen. Das zeigen die Siege gegen zumindest gleich starke Gegner wie Frankreich und die Niederlande. Vor allem aber beeindruckte, wie gewonnen wurde. Nagelsmann ist der jüngste Trainer in der Geschichte des Deutschen Fußball Bundes. Vielleicht wirkt er deshalb unverkrampft gegenüber den politischen und gesellschaftlichen Vorgängen und Stimmungen. Wie so viele seiner Altersgenossen scheinen ihn solche Themen wenig zu berühren. Sein jugendliches Alter und das seines Co-Trainer Sandro Wagner ließen zuerst Zweifel aufkommen an ihrer Eignung. Aber Nagelsmann war schon in Hoffenheim, Leipzig und zuletzt beim FC Bayern München sehr erfolgreich gewesen. Als jedoch der prominentere Thomas Tuchel als Trainer frei wurde, musste Nagelsmann diesem Platz machen. Er nahm es gelassen und unaufgeregt. Tuchel war zwar nicht so erfolgreich wie Nagelsmann, aber bei den Bayern zählt nicht nur der Erfolg sondern auch das „Mia san Mia“, das öffentliche Ansehen. Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick und Joachim Löw waren andere Trainertypen. Aufgrund des Altersunterschieds waren sie eher Vaterfiguren. Dagegen sind Nagelsmann und Wagner eher der Typ des gleichaltrigen Mitspielers, haben sogar mit manchem der Spieler zusammen auf dem Platz gestanden. Eine ähnliche Situation liegt auch bei Xabi Alonso und Bayer Leverkusen vor. Vielleicht macht das ihren Erfolg aus und dass bei ihnen anscheinend andere Überlegungen als die rein sportlichen keine Rolle spielen. Wer gut spielt, steht auf dem Platz. Findet unter ihnen ein Wandel im Verständnis von Spiel und Zusammenspiel statt? Sie treten auf wie eine Boy-Group ohne erkennbaren Chef und Leiter, mit flacher Hierarchie. Das ist vielleicht das Wesentliche ihrer Generation. Sie scheinen sich wenig zu scheren um das Urteil von anderen und deren Erwartungen. So etwas wie „work-live-balance“ liegt da in der Luft, Freude am Spiel scheint bedeutender zu sein als Image, große Namen, großes Geld oder sonstige Überlegungen. Vielleicht findet im Fußball eine Rückbesinnung auf das Wesentliche statt: Die Freude am Spiel statt der Missionierung durch Sport, auch wenn sich gerade im Verhältnis zu Russland und Weißrussland etwas anderes offenbart. Aber erst im Rückblick der Jahre wird sich zeigen, ob diese Annahmen sich als wahr herausstellen und ob sie die Stimmung in der Gesellschaft widerspiegelten. Auch in den gesellschaftlichen Diskussionen scheint diese Frage immer mehr in den Vordergrund zu rücken: Worauf kommt es an im Leben? Rüdiger Rauls ist Reprofotograf und Buchautor. Er betreibt den Blog Politische AnalyseDeborah Feldmanns Kampf gegen staatlichen Antisemitismus
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenDirekt-Link Episode herunterladen Audio-Player:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenDer noch fruchtbare Schoß
JackPod-Streitgespräch: FDP versus die Linke über die Wirtschaft
 Michael Theurer, FDP, ist Mitglied im Europäischen Parlament, seit 2013 Vorsitzender des FDP-Landesverbands Baden-Württemberg sowie Mitglied im FDP-Präsidium, wo er zuständig für die Bereiche Wirtschaft und Arbeit ist.
(Foto: Website Michael Theurer)
Michael Theurer, FDP, ist Mitglied im Europäischen Parlament, seit 2013 Vorsitzender des FDP-Landesverbands Baden-Württemberg sowie Mitglied im FDP-Präsidium, wo er zuständig für die Bereiche Wirtschaft und Arbeit ist.
(Foto: Website Michael Theurer)
 Sascha Bahl, die Linke, ist Bundestagsdirektkandidat für den Kreis Bergstraße, Delegierter des Landesparteitages, Delegierten des Landesrates und beratendes Mitglied des Landesvorstandes Hessen gewählt worden.
(Foto: Website: Sascha Bahl)
Audioplayer:
Podcast downloaden
Soundcloud:
Sascha Bahl, die Linke, ist Bundestagsdirektkandidat für den Kreis Bergstraße, Delegierter des Landesparteitages, Delegierten des Landesrates und beratendes Mitglied des Landesvorstandes Hessen gewählt worden.
(Foto: Website: Sascha Bahl)
Audioplayer:
Podcast downloaden
Soundcloud:

Die SPD und Gerechtigkeit: Mit dem Schulz-Zug an den Menschen vorbei gerast
So schwammig wie möglich, so unkonkret wie nötig
Was denken Sie, wenn Sie an Gerechtigkeit denken? Was verbinden sie damit? Und falls Sie zu einem Ergebnis gekommen sind: Wie lässt sie sich herstellen? Bei Wikipedia heißt es gleich in der Einleitung zum Artikel „Gerechtigkeit“:Nach Platons Verständnis ist Gerechtigkeit eine innere Einstellung. Sie ist für ihn die herausragende Tugen (Kardinaltugend), der entsprechend jeder das tut, was seine Aufgabe ist, und die drei Seelenteile des Menschen (das Begehrende, das Muthafte und das Vernünftige) im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Klingt jetzt nicht gerade massentauglich, schon gar nicht, um selbige zu begeistern. Aber Schulz und die SPD meinten auch weniger Platon Definition von Gerechtigkeit, sondern … ja, sondern was eigentlich? Schauen wir uns mal ein paar Abstufungen an.Klingt jetzt nicht gerade massentauglich, schon gar nicht, um selbige zu begeistern. Aber Schulz und die SPD meinten auch weniger Platons Definition von Gerechtigkeit, sondern … ja, sondern was eigentlich? Schauen wir uns mal ein paar Abstufungen an.
Gerechtigkeit unter dem Aspekt Bedürfnisprinzip oder Gleichheitsprinzip
Das Gleichheitsprinzip klingt eindeutig. Alle haben gleich viel. Will die SPD also Gerechtigkeit nach dem Gleichheitsprinzip? Sicher nicht, denn sie unterscheidet ja zwischen „hart arbeitenden Menschen“ und dem Rest, wobei schon diese Gliederung natürlich nicht gerade als effektiver Stimmenfänger taugt. Denn wann arbeitet man hart? Wann nicht? Und was ist mit denen, die durch dieses abstrakte Raster fallen? Man weiß es nicht, aber es ist klar, dass Schulz nicht das Gleichheitsprinzip meinen kann. Suchen wir also weiter. Ist es vielleicht das Bedürfnisprinzip, das die SPD unter Gerechtigkeit versteht? Gerechtigkeit also, die den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird und so ein Größtmaß an Zufriedenheit schafft? Sollte es so sein, versteht die SPD es gut, das zu verstecken. Denn neben der Lieblingszielgruppe der eben erwähnten hart arbeitenden Menschen muss man suchen, wenn man eine Politik entdecken will, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Ein Bedürfnis wäre beispielsweise eine Form der Freiheit, die auf Sanktionierungen von Arbeitslosen verzichtet. Ein Bedürfnis wäre eine Rente, von der man gut leben kann. Ein Bedürfnis wäre Arbeit, die auch nach dem 20. jeden Monats noch einen vollen Kühlschrank ermöglicht. Das sind Grundbedürfnisse, die die SPD programmatisch aber – wenn überhaupt – nur streift. Stattdessen bleibt sie vage, ergießt sich in Flickschusterei, die die Menschen – und ihre Bedürfnisse! – nicht erreicht.Gerechtigkeit nach dem Leistungsprinzip
Hier kommen wir der Sache schon näher. Wir wissen ja alle, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, ob wir wollen oder nicht. Auch deshalb ist es kein Zufall, wenn Schulz sich ganz besonders auf die hier abermals erwähnten hart arbeitenden Menschen fokussiert. Damit sagt er eine Menge, nämlich, dass Leistung im Vordergrund steht. Wie wissen zwar immer noch nicht, wann wer nun eigentlich ausreichend Leistung erbringt, die den Titel „hart arbeitend“ rechtfertigen würde. Aber eben das ist ja das Prinzip, nach dem Schulz und die SPD verfahren. Sie bleiben unkonkret, so dass sich theoretisch fast jeder angesprochen fühlen kann. Oder eben fast jeder sich nicht angesprochen fühlen kann, und das ist es, was die SPD seit dem rasanten Start des „Schulz-Zugs“ erlebt: Abkehr. Die Wähler hören wohl die Botschaften, aber als Adressaten empfinden sie sich immer seltener. Zwar folgt das Leistungsprinzip dem vermeintlichen Ansporn, dass, wer mehr leistet, auch mehr bekommt. Doch die Zielgruppe für dieses Verfahren schrumpft seit Jahren, weil sich Leistung eben immer seltener wirklich lohnt. Wer in die Armut hineingeboren wird, kann schon fast die Uhr danach stellen, dass sich daran nichts ändert, denn die attraktiven Arbeitsplätze werden meist untereinander aufgeteilt, sie werden vererbt wie die dahinter stehenden Vermögen. Als hart arbeitender Mensch ist Aufstieg nicht nur nicht garantiert, sondern eher unwahrscheinlich, wenn der persönliche Backround fehlt. Man bleibt halt gern unter sich, mehr Leistungsprinzip wird in den betroffenen Kreisen nur ungern akzeptiert. So gesehen ist harte Arbeit nichts, was automatisch belohnt wird. Und so gesehen ist der Begriff der Leistungsgerechtigkeit auch nicht korrekt. Denn nach dem Leistungsprinzip bekommt zwar mehr, wer mehr leistet. Doch wer mit drei Jobs noch immer nicht zurechtkommt, weil die Bezahlung unterirdisch ist, der stößt an seine Leistungsgrenzen, und mehr bekommt er dafür nicht, im Gegenteil. Also auch nicht das, wonach wir bei der SPD suchen.Das autoritäre Machtprinzip
Wir sind mitten drinnen im autoritären Machtprinzip, das jedem zwangsweise zuordnet, was er bekommt. Das wissen Minijobber ebenso wie Arbeitslose, das wissen Rentner wie Alleinerziehende, das wissen Kinder in Armut genauso wie Leiharbeiter. Die Bevölkerungsgruppen, die selbst keine Entscheidungsbefugnis mehr haben, weil ihnen die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür fehlen bzw. genommen werden, wachsen stetig und kontinuierlich an. Immer weniger haben immer mehr, und immer mehr müssen mit immer weniger zurechtkommen. In einem solchen Korsett, das Kopf und Herz zuschnürt und für schlechten Schlaf sorgt, kommt kaum ein Gefühl für Gerechtigkeit auf, schon gar keins für Chancengleichheit im Rahmen einer Leistungsgesellschaft. Nach außen leben wir nicht nach dem autoritären Machtprinzip, doch die Praxis sieht anders aus. Deshalb ist das Thema Gerechtigkeit als Wahlkampfbegriff eine denkbar schlechte Wahl, Schulz hätte stattdessen auch „Freiheit“ oder „Frieden“ verwenden können, die Menschen hätten sich auch darin nicht wiederfinden können. Zum einen, weil die Begriffe konträr zur Lebenswirklichkeit vieler Menschen stehen. Da wird vom Frieden geredet, während gleichzeitig offen und aggressiv der Ost-West-Konflikt angeheizt wird. Welcher Bürger soll mit dieser Diskrepanz zurechtkommen? Das wird von Freiheit schwadroniert, während die Menschen feststellen, dass die NSA-Angriffe der Vergangenheit nur die Spitze eines Eisberges waren, der in der massenhaften Ausspähung der eigenen Bürger (vorläufig) gipfelt. Und dann kommt die Gerechtigkeit hinzu, die nebulös wirkt, ohne Reiz, ohne Charme, ohne Konkretes. Auch hier sehen die Menschen ihre Lebenswirklichkeit auf der einen und Schulz‘ geschliffenen Worte auf der anderen Seite.Gerechtigkeit als Rohrkrepierer
Es ist keineswegs wo, dass die SPD mit dem Thema Gerechtigkeit auf ganzer Linie falsch lag. Im Gegenteil, es wäre sogar ausgezeichnet gewesen, um einen spannenden Wahlkampf aufkommen zu lassen. Und es ist auch nicht so, dass – auch wenn uns das zahlreiche Medien glauben machen wollen – die Menschen das Gefühl hätten, es gebe genug Gerechtigkeit im Land. Viele sind sensibel genug und spüren ganz genau, dass es ungerecht zugeht in Deutschland, und dass diese Ungerechtigkeit zunimmt, in erschreckendem Maße zunimmt. Und genau dieselben Menschen erkennen auch, wenn es jemand wie Schulz nicht ernst meint. Leider sind sie aber nicht sensibel genug, um zu erkennen, dass die Unterschiede inzwischen kaum noch vorhanden sind, leider auch nicht sensibel genug, um linken Alternativen eine echte Chance zu geben. Aber eben doch in der Lage, um Schulz zu durchschauen. Das ist der Grund für den drastischen Absturz von Schulz und der SPD. Die Sozialdemokraten haben ein Thema mit großem Potenzial zu einem Rohrkrepierer gemacht. Die Wähler werden es ihnen im September „danken“. Leider läuft es darauf hinaus, dass erneut Merkel das Heft in der Hand behalten wird. Die kann aber hinterher von sich behaupten, dass es ihr sowieso nie um Gerechtigkeit ging. Die Wähler können also durchatmen. Und sich mächtig ärgern. Denn sie haben zwar Schulz durchschaut, aber wenn sie Merkel wählen, hat die ganz eindeutig die effizienteren Methoden gehabt, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Gerecht ist das nicht. Aber was ist schon gerecht? [InfoBox]Rauchende Colts: Wer hat was warum beim G20-Gipfel gemacht? (Podcast)
 Weitere Infos:
Weitere Infos:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen